Startseite » Ratgeber » Vorerbe und Nacherbe im Testament: So vermeiden Sie Konflikte
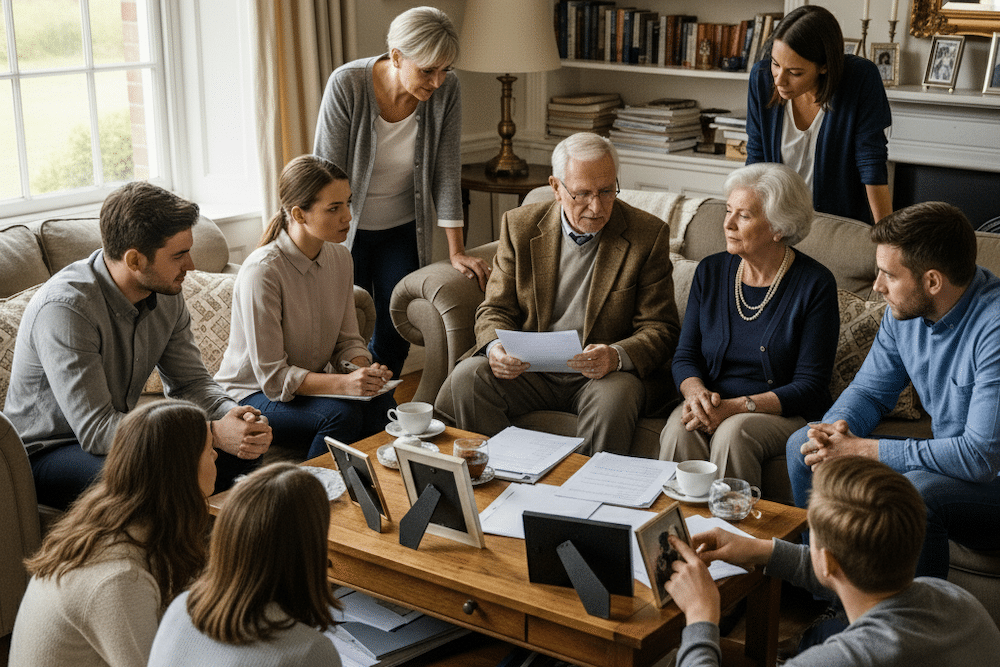
Durch die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft im Testament legt der Erblasser fest, wer den Nachlass zunächst erhält und wann dieser weitergegeben wird. Zunächst wird ein Vorerbe bestimmt, der das Erbe für eine gewisse Zeit nutzen darf. Erst wenn die Vorerbschaft endet, sofern nichts anderes vereinbart ist, das in der Regel mit dem Tod des Vorerben, tritt der Nacherbe an dessen Stelle. Es kann also gesagt werden, dass der Vorerbe sozusagen ein Erbe auf Zeit ist.
Wichtig zu beachten: Der Nacherbe erbt nicht vom Vorerben, sondern direkt vom ursprünglichen Erblasser. Damit auch für den Nacherben noch Vermögen vorhanden ist, sind die Rechte des Vorerben eingeschränkt, er kann also nicht völlig frei über den Nachlass verfügen.
(Quelle: afilio)
Eine Vor- und Nacherbschaft entsteht niemals automatisch durch das Gesetz, sondern ausschließlich durch eine ausdrückliche Verfügung im Testament oder Erbvertrag. Besonders häufig wird die Regelung eines Vorerbes in Ehegattentestamenten genutzt. Damit soll zum einen die finanzielle Absicherung des überlebenden Ehepartners gewährleistet werden, zum anderen bleibt jedoch auch sichergestellt, dass das Vermögen später an die gemeinsamen Kinder oder andere vorgesehene Nacherben übergeht. Darüber hinaus kann die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft auch als strategisches Mittel zur Sicherung des Vermögens sinnvoll sein. Oft ist dies in Kombination mit einer Testamentsvollstreckung der Fall, beispielsweise bei Unternehmensnachfolgen, Testamenten nach einer Scheidung, Patchwork-Familien oder auch bei Fällen, in denen mögliche Erben bereits verschuldet sind.
Eine Vorerbschaftsregelung wird meist dann sinnvoll, wenn eine Person vom Erbe ausgeschlossen werden oder mehrere Generationen am Erbe beteiligt werden sollen. Aber auch, wenn beispielsweise ungeborene Nachkommen beim Erbe noch bedacht werden sollen.
Mit dem Eintritt des Erbfalls wird der Vorerbe unmittelbarer Erbe, während der Nacherbe lediglich das sogenannte Anwartschaftsrecht erhält. Zum Schutz der Nacherben ist die Verfügungsbefugnis des Vorerben eingeschränkt. Wenn der Vorerbe etwa Grundstücke verkauft, Belastungen aufbringt oder Nachlassvermögen verschenkt, sind diese Maßnahmen unwirksam, sofern dadurch die Rechte des Nacherben beeinträchtigt würden. Der Vorerbe ist verpflichtet, den Nachlass sorgfältig zu verwalten und die üblichen Erhaltungskosten zu tragen.
Auf Wunsch des Nacherben muss der Vorerbe ein Nachlassverzeichnis erstellen, das gegebenenfalls notariell aufgenommen werden kann. Zudem besteht eine Rechenschaftspflicht, falls der Nacherbe begründet nachweisen kann, dass der Vorerbe durch seine Verwaltung die Interessen des Nacherben erheblich verletzt.
Zum Nachlass, der dem Nacherben zusteht, gehört alles, was der Vorerbe aus einem Erbschaftsrecht oder als Ersatz für beschädigte, zerstörte oder entwendete Erbschaftsgegenstände erhält, sowie Erwerbungen aus Mitteln des Nachlasses, sofern diese nicht ausschließlich zu dessen Nutzung dienen. Wenn der Vorerbe aus der Erbschaft weitere Rechte oder Ansprüche erlangt, gehören diese zum Nachlass für den Nacherben.
Dies bedeutet beispielsweise:
Wenn ein geerbtes Haus abbrennt und der Vorerbe dafür eine Versicherungssumme erhält oder, wenn ein geerbtes Auto gestohlen wird und der Erbe Schadenersatz erhält, gehören das Geld bzw. der Ersatz zum Nachlass des Nacherben. Ebenso, wenn der Vorerbe mit dem Geld aus der Erbschaft etwas Neues kauft (z. B. Aktien oder ein Grundstück), auch dann gehört das zum Nachlass für den Nacherben.
Ausnahme: Wenn der Vorerbe das Geld nur für die Nutzung eingesetzt hat (z. B. er kauft etwas, um es vorübergehend zu gebrauchen oder verbraucht Zinsen für seinen Lebensunterhalt), dann gehört das nicht automatisch zum Nachlass.
Der Erblasser kann den Vorerben von einigen Verfügungsbeschränkungen und Pflichten befreien. Dies bezieht sich vor allem auf das Verfügungsverbot bezüglich Immobilien und die Pflicht zur ordnungsgemäßen Nachlassverwaltung und Rechenschaftslegung. Hier wird dann vom befreiten Vorerben gesprochen. Befreit wird der Vorerbe allerdings nur dann, wenn der Erblasser das ausdrücklich so im Testament bestimmt. Der Nacherbe wäre so weniger geschützt, weil der Vorerbe mehr Entscheidungsspielraum erhält.
(Quelle: erbrecht, erbrecht ratgeber)
Wenn der Vorerbe selbst zu den pflichtteilsberechtigten Personen gehört, muss er die mit einer Vor- und Nacherbschaft verbundenen Einschränkungen nicht hinnehmen. In diesem Fall kann er die Vorerbschaft innerhalb einer Frist von sechs Wochen ausschlagen und stattdessen seinen Pflichtteil verlangen. Der Vorerbe steht also vor der Wahl: Nimmt er die Erbschaft an, die er später an die Nacherben weitergeben muss, oder entscheidet er sich für den sofortigen Pflichtteilsanspruch.
Auch der Nacherbe kann pflichtteilsberechtigt sein. Der Nacherbe kann seinen Pflichtteil ebenfalls nur dann fordern, wenn er die Nacherbschaft ausschlägt. Der Pflichtteilsanspruch unterliegt der allgemeinen Verjährung von 3 Jahren, die zum Ende des Jahres entsteht, in dem der Pflichtteilsanspruch entstanden ist. Dies ist der 1. Erbfall. Die Frist beginnt nicht erst mit der Ausschlagung der Nacherbschaft. Wird die Nacherbschaft nach 4 Jahren ausgeschlagen, ist der Pflichtteilsanspruch bereits verjährt.
Ein nicht zu unterschätzender Punkt für den Erblasser bei der Testamentserstellung ist, dass er sich im Klaren darüber sein sollte, dass etwaige Pflichtteilsansprüche ggf. zu unvorhergesehenen Belastungen oder Liquiditätsengpässen in Bezug auf das Erbe führen können.
Wenn ein Erblasser eine Vor- und Nacherbschaft anordnet, gibt es steuerlich zwei Erbfälle:
Erster Erbfall:
Der Vorerbe erbt vom Erblasser.
Zweiter Erbfall:
Später, wenn der Vorerbe verstirbt oder das Nacherbenrecht eintritt, erbt der Nacherbe vom ursprünglichen Erblasser und nicht vom Vorerben.
Das bedeutet: Für das Finanzamt gilt, dass der Nachlass zweimal versteuert wird – einmal beim Vorerben und einmal beim Nacherben. Nach § 6 ErbStG gilt: Der Vorerbe wird wie ein Erbe behandelt. Sobald die Nacherbfolge eintritt, müssen die Nacherben ihren Erwerb steuerlich so erfassen, als hätten sie ihn vom Vorerben erhalten. Auf Antrag kann jedoch das Verwandtschaftsverhältnis des Nacherben zum ursprünglichen Erblasser zugrunde gelegt werden, was häufig steuerlich günstiger ist. Und: In vielen Fällen fällt dem Nacherben nicht nur der Nachlass des Erblassers, sondern zusätzlich auch das eigene Vermögen des Vorerben zu. Beide Erwerbe sind steuerlich getrennt zu erfassen und entsprechend zu versteuern.
Die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft kann ein sinnvolles Instrument sein, um den Nachlass langfristig zu steuern und bestimmte Personen abzusichern. Besonders häufig wird die Vorerbschaftsregelung gewählt, wenn der Erblasser seinen Ehepartner nach dem eigenen Tod finanziell versorgen möchte, gleichzeitig aber sicherstellen will, dass das Familienvermögen später an die gemeinsamen Kinder oder andere Wunsch Erben weitergegeben wird. In solchen Fällen schafft die Vorerbschaft klare Strukturen und verhindert, dass Vermögenswerte in „fremde Hände“ gelangen.
Allerdings bringt die Vorerbschaft auch Nachteile mit sich: Der Vorerbe ist in vielen Entscheidungen eingeschränkt, da er den Nachlass nur verwalten, nicht aber nach Belieben verbrauchen oder veräußern darf (Ausnahme: befreiter Vorerbe). Für die Nacherben kann diese Regelung Sicherheit bedeuten, für den Vorerben aber eine deutliche Belastung und Einschränkung der Freiheit. Zudem sind steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, da das Vermögen grundsätzlich zweimal der Erbschaftsteuer unterliegt. Ob eine Vorerbschaft also sinnvoll ist, hängt stark von den persönlichen Zielen des Erblassers ab.
Der Vorerbe muss beachten, dass er 2 getrennte Vermögensmassen verwahrt, nämlich einmal die Erbschaft, einmal sein eigenes Vermögen. Beide Vermögensmassen können nach dem Ableben des Vorerben unterschiedlichen Personen zufallen. Werden die Vermögen nicht streng voneinander verwaltet, kann es beim Ableben des Vorerben zu Streitigkeiten zwischen den Nacherben und den eigenen Erben des Vorerben kommen. Verkauft zum Beispiel der befreite Vorerbe einen Grundbesitz, vermischt den Erlös mit eigenem Guthaben auf seinem Konto, unter verbraucht ein großen Teil des Guthabens, stellt sich im Erbfall die Frage, ob der Verbrauch das eigene Vermögen des Vorerben betrifft oder aber das Vermögen aus der Erbschaft.
Das Instrument der Vor- und Nacherbschaft sollte nur nach reiflicher Überlegung und Einholung anwaltlicher Beratung gewählt werden. Es kann in einigen Situationen sinnvoll sein, in anderen Situationen aber auch Probleme schaffen.


Ihre Fachanwaltskanzlei aus Mönchengladbach.

Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.


Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.

Sascha Fellner
Freier Mitarbeiter
Fachanwalt für: Miet- & Wohneigentumsrecht
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Sascha Fellner
Freier Mitarbeiter
Fachanwalt für: Miet- & Wohneigentumsrecht

Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.

Jutta Dautzenberg
Angestellte Rechtsanwältin
Fachanwältin für: Familienrecht
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Jutta Dautzenberg
Angestellte Rechtsanwältin
Fachanwältin für: Familienrecht

Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.

Andreas Hammelstein
Partner
Fachanwalt für: Bau-, Architekten & Verkehrsrecht
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Andreas Hammelstein
Partner
Fachanwalt für: Bau-, Architekten & Verkehrsrecht

Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.

Dr. Vanessa Staude
Partnerin
Fachanwältin für: Arbeits-& Familienrecht
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Dr. Vanessa Staude
Partnerin
Fachanwältin für: Arbeits-& Familienrecht

Der Rechtsanwalt überprüft nach Anfrage Ihre Angaben, ob eine kostenpflichtige Erstberatung erforderlich/sinnvoll ist. Es wird keine Rechtsberatung erteilt.

Ralf Maus
Partner
Fachanwalt für: Erbrecht
Der Rechtsanwalt berät Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach eingehender Prüfung des (von Ihnen mitzuteilenden) Sachverhaltes. Die mündliche Erstberatung kostet maximal 190 € zzgl. Mehrwertsteuer, die schriftliche maximal 250 € zzgl. Mehrwertsteuer.

Ralf Maus
Partner
Fachanwalt für: Erbrecht